SKM
Rastatt

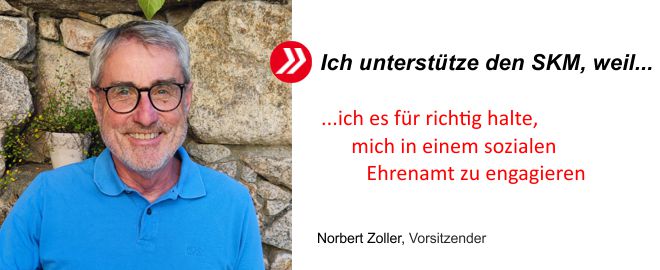
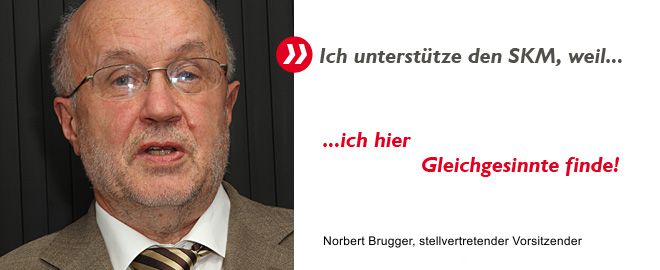

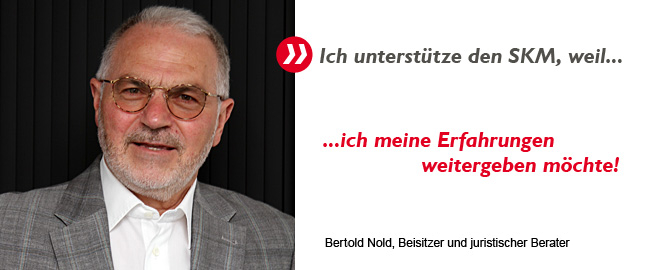

Vor dem Hintergrund sexueller Gewalt insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Einrichtungen und Pfarreien begann innerkirchlich und in der Caritas vor einigen Jahren eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema.
Leitmotiv wurde die Idee „Caritas – ein sicherer Ort“.
Dahinter steht der Persönlichkeitsschutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen. Sowohl der Caritasverband als auch die Erzdiözese Freiburg erarbeiteten Leitlinien zur Prävention sexueller Gewalt, zum Umgang bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für den Verdacht auf sexuelle Gewalt und den Umgang mit zurückliegenden Fällen. Die Erzdiözese entwickelte für Mitarbeiter eine Verpflichtungserklärung zum grenzachtenden Umgang mit Schutzbefohlenen.Aufgrund zurückliegender Erfahrungen insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit war die Sensibilisierung für das Thema in Einrichtungen mit diesem Schwerpunkt besonders früh gegeben.
In letzter Zeit wurde jedoch deutlich, dass auch in Bereichen der Erwachsenen-/ Behindertenarbeit die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema an Bedeutung gewann. In Studien (z.B. Monitoringausschuss zur UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderung) wurde die besondere Hilfsbedürftigkeit von geistig Behinderten und alten Menschen mit Behinderung bei dem Thema sexueller Übergriffe ins Blickfeld gerückt. Von da war der Weg nicht mehr weit, dass auch Vereine wie der SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste sich mit der Frage des Anvertrautenschutzes beschäftigten. Auch die Umsetzung der Verpflichtungserklärung für alle Mitarbeiter in den Verbänden erforderte eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Herausforderung ist in den SKM-Vereinen eine Zweifache. Zum Einen ist der Fokus des gesellschaftlichen Dialogs beim Thema sexuelle Gewalt eher bei Kindern und Jugendlichen und (noch) nicht bei Behinderten. Zum Anderen wurde die Entwicklung fachlicher Standards mit dem Thema meist im Rahmen hauptberuflich beschäftigter Fachleute diskutiert.
Der SKM-Rastatt ist einer von 14 Vereinen in der Erzdiözese Freiburg, der sich im Schwerpunkt mit der rechtlichen Betreuung beschäftigt. In der Erzdiözese Freiburg werden im SKM überwiegend Ehrenamtliche in dieser Aufgabe tätig und führen über 2000 Betreuungen. Im SKM-Rastatt sind aktuell 79 Ehrenamtliche tätig die insgesamt 120 Betreuungen führen. Betreuung für Menschen, die ihre rechtlichen Angelegenheiten aufgrund einer geistigen, körperlichen oder auch seelischen Behinderung selber nicht mehr erledigen können. Im SKM-Rastatt treffen sich die Ehrenamtlichen in örtlichen Gruppierungen um über Erfahrungen aus ihren Aufgabenfeldern der Vermögenssorge, der Gesundheitsfürsorge und der Aufenthaltsbestimmung auszutauschen. In diesen bestehenden Arbeitskontext betteten wir die Frage des Anvertrautenschutzes ein. Ausgangspunkt war hierbei das Fortbildungsmodul zum Anvertrautenschutz vom Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg.
Was tun, wenn Grenzverletzungen bei Betreuten passieren? Wie sensibilisiere ich mich für eigenes grenzachtendes Verhalten im Kontakt mit Betreuten?
Fragen, die sich ehrenamtlich rechtliche Betreuer in ihrem Erfahrungsaustausch im SKM-Rastatt gestellt haben. Wenn Menschen in stationären Einrichtungen leben, von ambulanten Diensten betreut werden oder in beschützten Werkstätten leben, dann haben sie besonderen Schutz zu erwarten. Der rechtliche Betreuer ist die Person, die darauf achten soll, dass dieser Schutz gewährt wird.
Was heißt das aber nun konkret – wo fängt dieser Schutz an? Und wie weit kann die Frage gehen? Ein Prozess der Sensibilisierung für das Thema begann durch die Diskussion des Arbeitspapiers zum Verhaltenskodex im Umgang mit (sexueller) Gewalt aus den Arbeitsmaterialien zur Prävention in der Erzdiözese Freiburg. In diesem geht es in Form einer Verkehrsampel um ein Handlungskonzept, eine Leitlinie zur Reflektion der eigenen Handlungen und der beobachteten Handlungen aus der Umgebung der Betreuten.
- rot= Handlungen, die immer falsch und verboten sind und deshalb rechtliche Konsequenzen haben
- gelb= Handlungen die in unserem Arbeitsbereich nicht erwünscht sind und deshalb nicht vorkommen sollen und
- grün= Handlungen die in unserem Arbeitsbereich legitimiert und fachlich begründet sind vor.
In der Auswertung (hier auszugsweise einige Ergebnisse) stellten die ehrenamtlichen Betreuer fest, dass in ihrem Arbeitsfeld
„rote Handlungen“ sind: Drohungen auszusprechen, Menschen in hilfloser Lage zurückzulassen, hinter dem Rücken des Betreuten zu handeln, gegen den Willen des Betreuten zu handeln( Ausnahmen wurden auch diskutiert), Waschen trotz Verweigerung des Betreuten, Betreute (psychisch) unter Druck zu setzen, körperliche und sexuelle Gewalt.
„gelbe Handlungen“ sind: bevormunden, Androhung : wenn der Betreute das nicht macht, dann gibt es Konsequenzen…,nicht einbeziehen bei Entscheidungen (Einkäufe, Finanzverwaltung etc.), eigene Lebensvorstellungen dem Betreuten überstülpen, autoritäre Umgangsform, unter Druck setzen.
„Grüne Handlungen“ sind: dem Betreuten sich als Gegenüber anbieten mit klarer Meinung und eigenen klaren Grenzen. Ratschläge sind erlaubt – z.B. Betreute soll sich anders anziehen. Im Dialog auf gleicher Ebene reden (Augenhöhe bei Rollstuhlfahrern und Bettlägrigen beachten). Handlungsweisen absprechen. Gegen den Willen des Betreuten muss gehandelt werden, wenn freiheitsentziehende Maßnahmen zum Wohl des Betreuten zu treffen sind, die betreuungsgerichtlich genehmigt wurden. Grenzsetzung bei Verschwendungssucht/Spielsucht. Hier hat der Betreuer ggf. einen Einwilligungsvorbehalt zu beantragen. Eigene Vorstellung im Gespräch klar benennen.
Aus den Alltagserfahrungen erkannten die Ehrenamtlichen, dass das Thema sexuelle Gewalt eine Öffnung für die Themen kommunikative, strukturelle und persönliche Gewalt herstellt. Fragen an das eigene Verhalten wurden miteinander diskutiert wie z.B.: Ist es o.k. wenn ich bei einem bettlägrigen Betreuten mich auf sein Bett setze? Wie kommuniziere ich das? Treffe ich Absprachen mit dem Pflegepersonal zur Einteilung von Zigaretten – zur Gesundheitssorge und zur Geldeinteilung – oder lasse ich den Betreuten die Einteilung selbst und in Absprache mit mir treffen?
Aber auch Fragen, die sich auf die Vertretung von Rechten des Betreuten gegenüber Dritten bezogen.
Was tue ich, wenn ich erlebe, dass Schwestern im Heim ins Zimmer zum Betreuten ohne Anklopfen hineingehen?
Was kann ich für einen Betreuten tun, dessen Anspruch auf Sozialleistungen abgelehnt wurde und er mittellos da steht?
Welche ambulanten Sozialleistungen kann ich für einen behinderten Menschen, der noch alleine lebt zur Verbesserung seines Lebensalltags organisieren?
Deutlich wurde, dass im Rahmen der ehrenamtlichen Betreuungen in den Diskussionsrunden kein Fall eines gewalttätigen oder sexuellen Übergriffs thematisiert wurde. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass ehrenamtliche Betreuungen bewusst durch die Vereine so vermittelt werden, dass Ehrenamtliche mit ihrer Aufgabe möglichst nicht überfordert werden. Indessen ist das Thema sexuelle und körperliche Gewalt im Rahmen hauptberuflicher Betreuungen insbesondere bei psychisch kranken Betreuten ein häufiges Thema.
Wichtiges Fazit der Diskussion in den Betreuergruppen war: Diese Diskussion kann nur ein Anfang sein. Es ist wichtig eigene Grenzziehungen vorzunehmen und dem Schutz der Grenzen für den Betreuten Raum zu geben. Wenn wir dieses in regelmäßigen Diskussionen in Betreuertreffen tun, schaffen wir die Basis für einen sicheren Ort für Betreute im SKM.